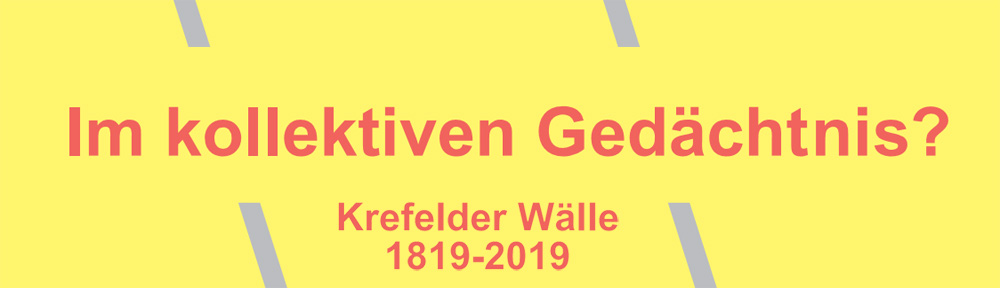Diskussionspapier der Initiative Stadtkultur Krefeld, Januar 2017
Intro / Diskussionspapier / Schreiben des LVR / Selbstverständnis / Aktivitäten / Plakataktion
Diskussionspapier zur Krefelder Stadtkultur 1819 – 2019
In Krefeld besteht der Konsens, dass – bezogen auf die Innenstadt – durch Entscheidungen in der Vergangenheit die historisch angelegten Qualitäten der Stadtgestalt erheblich beschädigt worden sind. Als Ausgangspunkt konstruktiver Überlegungen zur stadtgestalterischen Qualität Krefelds gilt der Stadtgrundriss von Adolph von Vagedes für Krefeld von 1819 mit seiner klassizistisch regelmäßigen Erweiterung und Einfassung des mittelalterlichen Stadtkerns sowie der bereits vollzogenen Stadterweiterungen durch ein prägnantes Wallrechteck. Dieses Rechteck der vier Wälle ist immer wieder in eine Reihe mit der rationalen Stadtplanung in den „Mannheimer Quadraten“ im 17. Jahrhundert und mit dem Holländischen Viertel in Potsdam zu Beginn des 18. Jahrhunderts gestellt und als ein herausragendes Beispiel klassizistischer Stadtplanungen gewürdigt worden. Durch den Krefelder Stadtgrundriss ist eine markante Stadtgestalt realisiert worden (im Gegensatz zu der nur bruchstückhaften Realisierung der Pläne von Vagedes für Düsseldorf), die auf den klassizistischen ästhetischen Prinzipien der Regelmäßigkeit und geschlossenen Einheit beruht. Otto Brües vergleicht in seinem Roman „Der Silberkelch“ von 1949 den Vagedes-Plan sogar mit dem Grundriss der Kaiserstadt in Peking: „Sehen Sie denn nicht, wie hier der Stadtkern im Geviert der Wälle schwebt? Peking!“ Mit den Herberz-Häusern in Uerdingen, dem Greiffenhorst-Schlösschen, dem Haus Sollbrüggen u. a. Häusern sind inklusive der Parkanlagen weitere klassizistische Bauwerke in Krefeld erhalten. Diese zu pflegen und daran anzuknüpfen ist alleine schon im Sinne einer historischen Identität des Stadtbildes wünschenswert. Darüber hinaus kann der teilweise erhaltene Stadtgrundriss in ein erweitertes planerisches Generalmuster eingestellt werden, das sich durch das 100-Jahr-Jubiläum des Bauhauses im Jahre 2019 als aktueller Bezugspunkt anbietet. Das Bauhaus – 1919-25 Weimar, 1925-32 Dessau, 1932-33 Berlin – gehört mit den erhaltenen Bauten in Dessau zum Weltkulturerbe und gilt als maßgebliche Schule der modernen Architektur und des modernen Designs. Es knüpfte in seinen Gestaltungsgrundlagen an die Klassik an und ist heute selber ein Bezugspunkt der klassischen Moderne.
Krefeld kann für das Bauhaus-Jubiläum 2019 mit einer Reihe von Gestaltungslinien und Einsprengseln zur klassischen Moderne aufwarten. Die offensichtlichsten Ereignisse sind mit dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe und seinen Villen Haus Lange und Haus Esters sowie den Verseidag-Bauten verbunden. Nachdem Christiane Lange im Sommer 2013 mit dem „Mies 1:1 Golfclubprojekt“ einen temporären Mies-Bau realisiert hat, plant sie in Krefeld für 2019 ein größeres Projekt zu Mies van der Rohe – dem letzten der drei Direktoren des Bauhauses (1930-33). Die in Krefeld geborene und in Amsterdam tätige Architektin Claudia Schmidt hat mit „Vagedes 1819-2019“ ein Projekt angedeutet, das die klassizistische Epoche mit dem Bauhaus-Jubiläum verbindet. Wir meinen, dass alle diese Vorstellungen für Krefeld in einen erweiterten Rahmen eingestellt werden sollten, der bis in die heutige Zeit reicht.
Kaum im Stadtbild ablesbar, aber für das Image der Stadt Krefeld nicht weniger wichtig sind im Zusammenhang mit dem Bauhaus-Jubiläum die Verbindungen zur Lehre am Bauhaus. Johannes Itten, 1919 von Walter Gropius für die Vermittlung der künstlerischen Grundlagen an das Bauhaus in Weimar berufen, begründete mit seinen Kursen die „Vorlehre“, die von Weimar aus überall in der Welt als Grundlage der gestalterischen Ausbildung gilt. Itten leitete von 1932 bis 1938 die Höhere Fachschule für Textile Flächenkunst in Krefeld. Nachdem Itten 1923 aus dem Weimarer Bauhaus ausgeschieden war, übernahm Georg Muche einen der Vorkurse, vor allem aber leitete er die Klasse für Weberei. Muche wurde 1939 von Itten nach Krefeld gerufen und leitete an der von den Nationalsozialisten zeitweilig geschlossenen Höheren Fachschule für Textile Flächenkunst bis 1958 eine Meisterklasse für Textilkunst. Mit Gerhard Kadow war ein weiterer Meister des Bauhauses aus der Weberei in Krefeld tätig, von 1939 bis 1950 an der Textilingenieurschule, von 1949 bis 1967 an der Werkkunstschule. Ebenfalls in der Tradition des Vorkurses aus dem Bauhaus steht die umfangreiche Grundlehre an den ab 1949 gegründeten Werkkunstschulen, von denen die Krefelder Werkkunstschule durch ihren Leiter Friedrich G. Winter eine besondere Rolle spielte. Winter war rund 20 Jahre lang Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Werkkunstschulen, in der rund 20 der ehemaligen Kunstgewerbeschulen der Bundesrepublik zusammengeschlossen waren. Die Verbindung der Werkkunstschulen zum Bauhaus ergibt sich nicht nur durch die eng an den Vorkursen orientierte Grundlehre, sondern auch durch die ethische Verpflichtung bei der Ausbildung der Studierenden zu schöpferischen Persönlichkeiten, die eine kulturelle Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft eingingen. Die erhaltene Fassadenseite der ehemaligen Kunstgewerbeschule und späteren Werkkunstschule in Krefeld an der Ecke Petersstraße/Neue Linner Straße gehört daher ebenfalls zur Gestaltungstradition in Krefeld.
Im Zentrum der Planungen und Überlegungen zur Krefelder Stadtkultur 1819-2019 kann das klassische Erbe vom Vagedes-Plan über die Bauten von Mies van der Rohe bis zu den Werkkunstschulen als Grundlage für die heutige Identitätssuche der Stadt Krefeld gesehen werden. Dieses Erbe sollte in seiner Einheitlichkeit und Geschlossenheit bewahrt werden. Dazu gehören die angeführten Elemente eines in 200 Jahren gewebten Generalmusters, das in seinen Beispielen und Wirkungen erforscht und diskutiert werden sollte und als Ausgangspunkt zukünftiger Stadtentwicklung in einem Masterplan dienen kann. Es ist zu wünschen, dass Kulturpolitik und Stadtplanung in Krefeld an diese Qualitäten anknüpfen.
Ganz aktuell stellt sich diese Frage durch den geplanten Umbau/Neubau des jetzigen Seidenweberhauses (alternativ: Verlagerung der städtischen Veranstaltungshalle). Dadurch entstehen am Theaterplatz völlig neue Möglichkeiten, wieder an den alten Stadtgrundriss anzuknüpfen, denn mit dem Seidenweberhaus wurde der Theaterplatz mit Mediothek und Theater gegenüber der Innenstadt ausgegrenzt. Ein Ideenwettbewerb für die Neugestaltung auf der Grundlage des klassizistischen Stadtgrundrisses unter Einbeziehung der Verbindung zur Innenstadt wäre dringend erforderlich.
Für das Bauhaus-Jubiläum 2019 schlagen wir vor:
- Eine Erweiterung der meist isolierten Betrachtungsweise der Bauten von Ludwig Mies van der Rohe um die gestalterischen Verbindungen zur Stadt. Durch Veröffentlichungen und Ausstellungen könnte der planerische Code der Stadt Krefeld stärker herausgearbeitet werden.
- Die Auseinandersetzung mit dem Generalmuster der Stadt Krefeld sollte man durch wissenschaftliche und künstlerische Projekte vertiefen und begründen. Daran könnten sich die großen Krefelder Museen beteiligen: die Krefelder Kunstmuseen, das Museumszentrum Burg Linn, das Deutsche Textilmuseum in Linn sowie weitere Bildungseinrichtungen und der Fachbereich „Design“ der heutigen Hochschule Niederrhein.
- Die Kunst auf den Wällen sollt kritisch hinterfragt werden. Um Qualität für die Kunst auf den Wällen zu ermöglichen, sollte ein Kurator/eine Kuratorin oder eine Kunstkommission das letzte Wort haben. Auch die Kunst auf den Wällen sollte Teil eines Gesamtkonzeptes sein. Dazu könnten Symposien und temporäre künstlerische Installationen dienen, die sich mit dem orthogonalen Stadtgrundriss und den Wällen auseinandersetzen. Mit künstlerischen Installationen im öffentlichen Raum können Fragen aufgeworfen werden, Problemstellungen Transparenz erhalten und verborgene Ästhetik kann unerwartet entdeckt werden. Installationen mischen sich in das Alltagsleben, lösen Denkimpulse aus durch Störung vertrauter Sehgewohnheiten.
Langfristige Maßnahmen
- Der klassische Generalplan der Architektur in Krefeld sollte für die zukünftige Stadtgestaltung eine Orientierung darstellen. In Ansätzen ist das kleinteilig an den beiden Plätzen Anne-Frank-Platz und den Willy-Göldenbachs-Platz schon zu sehen. Hier sind die Plätze gegenüber dem Stadtraum klar abgegrenzt. Die Idee des englischen Square mit seiner Abgrenzung sollte bei weiteren Plätzen weiter entwickelt werden.
- Die von Claudia Schmidt vorgetragen Überlegungen zur Gestaltung des mittelalterlichen Kerns Krefeld müssten innerhalb des städtischen Generalplans gesondert behandelt werden, damit die Geschichte der Stadt ablesbar bleibt.
- Um diesen klassischen Generalplan der Krefelder Architektur zeitgemäß im Stadtbild umzusetzen, sollte die Stadt mit den ortsansässigen Architekten und Baugesellschaften in diesem Sinne kooperieren.
- Denkmalpflege und Gestaltungsbeirat sollen so ausgestattet werden, das sie beratend auch für Fassaden zuständig sein können, die formal nicht denkmalgeschützt sind. Hier verweisen wir auf Aktivitäten des Denkmalpflegers Pauwelen mit seinen Fassadenwettbewerbe, die wieder belebt werden sollten.
- Der Architekt Reymann hat von „Krefeld als Stadt der Alleen“ gesprochen. Alleen könnten das orthogonale Straßenmuster in weiten Teilen der Stadt betonen und sinnfällig machen.
Krefeld, Januar 2017
Initiative Stadtkultur Krefeld
Siegfried Gronert, Thomas Müller, Monika Nelles, Harald Hullmann